Hellmut Seemanns
Rede zum Jahresempfang
»Klein ist unter den Fürsten Germaniens freilich der meine;
Kurz und schmal ist sein Land, mäßig nur, was er vermag.
Aber so wende nach innen, so wende nach außen die Kräfte
Jeder; da wär‘s ein Fest, Deutscher mit Deutschen zu sein.«
Meine Damen und Herren,
16. Februar, Jahresempfang der Klassik Stiftung, 230. Geburtstag der russischen Zarentochter und späteren Großherzogin Maria Pawlowna – der Stubengarten ist erneut, Dank an die Gärtnerinnen und Gärtner, als kleiner Geburtstagsgruß im Spiegelsaal aufgestellt – alles wie immer. Schön, dass Sie wieder dabei sind, schön, dass wir im schönsten Saal unseres Landes zusammen sein dürfen.
Und doch, ich sehe es in Ihren Mienen, die Behaglichkeit, die sich mit der Beteiligung an einem durch Freiwilligkeit geadelten Ritual sonst einzustellen pflegt, diese gesellschaftlich fundierte Behaglichkeit erlebter Übereinstimmung, sie will sich nicht so recht einstellen.
Da ist ein unüberhörbarer, zugleich undefinierbarer Ton im Ohr, der uns ablenkt, ein kollektiver Tinnitus, eine Präokkupation, die wir alle mitgebracht haben, nein, die wir eben gerade nicht mitgebracht haben wie unseren Mantel, den man an der Garderobe abgeben kann, sondern ein Geräusch, das immer schon da zu sein scheint, bevor wir selber da sind, etwas, das uns zuvorkommt, das Besitz von uns immer schon ergriffen hat, bevor wir es begreifen können: Es ist die Sorge.

Eindrücke vom Neujahrsempfang der Klassik Stiftung Weimar. Foto: Candy Welz
Noch im letzten Jahr, nicht lange vor Weihnachten, lief mir ein Kollege, ein älterer Mann, auf dem Frauenplan über den Weg. Wir sehen uns selten und wenn, dann eigentlich immer auf der Straße; dann wechseln wir einige Worte und ziehen – uns einen schönen Tag wünschend – unserer Wege.
Ja, sagt er, am Wochenende sei er in Dresden gewesen. Wie schön, ermuntere ich ihn, mir zu erzählen, was er dort erlebt habe. Aber sein Blick spricht Bände. Ja, die Gemäldegalerie habe er sich noch einmal angesehen, die Sixtina, Dürer, Bellotto. Die semantisch düstere Betonung des Satzes liegt auf den Wörtern »noch einmal«. Wie ein Blitz fährt es mir durch den Kopf: Ist er bösartig erkrankt? Jedenfalls verbietet es sich jetzt genauso, nach dem »noch einmal« zu fragen wie das »noch einmal« schlicht zu überhören. Ich stocke.
Da schaut er mir mit weit aufgerissenen Augen direkt ins Gesicht: Stellen Sie sich vor, sie haben uns nicht einmal kontrolliert; jeder kann da einfach reinlaufen, bewaffnet, mit Brandsätzen. Die Terroristen werden das alles zerstören. Meine Sprachlosigkeit schien ihm natürlich. Vor mir stand ein Gebrochener, den nur die Gewissheit davon aufrecht zu erhalten schien, dass ein Verhängnis im Anzug sei:
Der Mann verkörperte die Sorge. Wir standen in Sichtweite zum Haus am Frauenplan.
Die eingangs zitierten Zeilen von Goethe sind – wie die meisten Zeilen von ihm – nicht im Haus am Frauenplan geschrieben worden. Goethe weilte im Auftrag seines Fürsten in Venedig, als er in so heiterem Licht, so zuversichtlich von Deutschland und den Deutschen schrieb. Dabei war auch er vermutlich nicht frei von Sorgen – um seine Lebensgefährtin, die mit einem Säugling in Weimar zurückgeblieben war; um seinen Fürsten, der sich wegen der Erwartung eines Krieges weit weg in Schlesien bei den preußischen Truppen aufhielt; vor allem aber wegen der Ereignisse in Paris, wo im zurückliegenden Jahr die Bastille erstürmt worden war. Gerade hatte sich die Welt verändert, das fühlten die Menschen, aber keiner konnte im Sommer 1790 sagen, in welche Richtung die Entwicklung gehen werde.
Goethe betrachtet im 17. Venezianischen Epigramm nicht seine Familie, also die private Sphäre, und er reflektiert auch nicht die weltgeschichtlichen Ereignisse, die das System der Staaten durcheinanderbringen kann, obwohl beide Welten, die ganz kleine und die ganz große, ihm Kopfzerbrechen bereiten. Goethe schaut auf das, was dazwischen ist, die öffentlichen Verhältnisse vor Ort, in Thüringen, und er beschreibt die Rolle, die er und seine Mitbürger in diesen Verhältnissen spielen könnten. Von privaten und weltgeschichtlichen Sorgen bedrängt, widmet er sich dem, was er überblicken kann: Das Land Sachsen-Weimar, kurz und schmal, ist der Gegenstand seiner Rede.
»Klein ist unter den Fürsten Germaniens freilich der meine; mäßig nur, was er vermag«, das führt sich Goethe, während er in Venedig auf die Herzoginmutter wartet, die er auf Wunsch ihres Sohnes Carl August nach Weimar geleiten wird, vor Augen. Aber wenn ihm die Weltlage Sorgen macht, wenn die in Weimar allein gelassene Familie ihn beunruhigt, so scheint die mäßige Macht seines Herzogs ihn nicht zu schrecken, im Gegenteil: Er entwirft ein Konzept für kleine Fürsten und schmale Länder.
Wirke doch jeder nach innen, nach außen, so wär’s, sagt er, ein Fest, Deutscher mit Deutschen zu sein.
Gerade nicht die Verschmelzung ist gemeint, nicht der große »Melting Pot«, sondern Goethe denkt an semipermeable Systeme. Aus dem Hin und Her des Nebeneinanders erwächst das erwähnte Fest, nicht aus der großen nationalen Vereinigung und der großstaatlichen Integration.

Eindrücke vom Neujahrsempfang der Klassik Stiftung Weimar. Foto: Candy Welz
Da ist sie also wieder, die Goethesche Idee des wirkenden Austausches, für die das territorial kleine Format die ideale Operationsbasis darstellt. Wie passt das zusammen mit seinen universalistischen Ideen? Mit Welterschließung, Weltgeschichte, Welttheater, Weltliteratur, mit Welterfahrung?
Wir müssen auf diese Fragen heute Abend keine abschließende Antwort finden. Aber deutlich kann uns schon jetzt sein, dass die Deutschen des 19. Jahrhunderts in dieser intellektuell anspruchsvollen Spannung, ja Spreizung ihr schmerzlichstes Problem mit Goethe empfunden haben. Was ihm als ein Fest vorschwebt, darin sah das Jahrhundert der Nationen, der Volksheere, der kolonialen Weltaufteilung nichts anderes als die schreckliche deutsche Kleinstaaterei. Und deutlich ist auch, dass diese verhasste Kleinstaaterei, für die die thüringischen Verhältnisse ein Musterbeispiel waren, historisch auf eine Familie zurückgeht. Es sind nicht »Die Müllers« oder »Die Lehmanns«, es sind in diesem Jahr und im Kontext der Thüringer Landesausstellung »Die Ernestiner«.
Ein falscher, nicht existenter Familienname, wie Prinz Michael von Sachsen-Weimar und Eisenach nicht müde wurde, protestierend zu bemerken.
Denn der Haus- und Familienname sei doch schlicht Sachsen. Aber, lieber Prinz Michael, liebe Wettiner, die heute Abend unter uns sind: Gewähren Sie Duldung für diesen Titel unserer Ausstellung! Stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn wir eine Thüringer Landesausstellung unter dem Titel »Das Haus Sachsen – eine Dynastie prägt Europa« ausgerufen hätten. Da würde der Freistaat Sachsen gleich den Botschafter des Freistaates Thüringen einbestellt haben. Also haben wir lieber von »Den Ernestinern« gesprochen, weil sich die Historiker angewöhnt haben, eben unter diesem Namen jenen Zweig des Hauses Sachsen zu benennen, dessen Territorium sich im Wesentlichen in den Landesgrenzen des heutigen Freistaates Thüringen befand.
Dass der Freistaat gerade eben wieder so heftig über Strukturen und Kreise, über ihren Zuschnitt und ihre Größe debattiert, das ist eine lustige Koinzidenz: Denn wie könnte unser Land das Erbe der »Ernestiner« gültiger zum Ausdruck bringen als durch diesen Streit. Thüringen ist historisch ganz bei sich, es wird sich gerade einmal wieder selbst historisch. Aber andererseits und ernsthaft: Eine »Weimarer Klassik«, ein »Ereignis Weimar – Jena um 1800«, eine Rolle Goethes und Weimars für das, was man die deutsche kulturelle Identität nennt, all dies hätte es ohne diesen ungewöhnlichen Zweig der Familie Sachsen, eben jene Ernestiner, nicht und niemals gegeben. Davon muss, davon wird die Ausstellung »Die Ernestiner« handeln.

Eindrücke vom Neujahrsempfang der Klassik Stiftung Weimar. Foto: Candy Welz
Wer das Weimarer Stadtschloss, wie vermutlich auch viele von Ihnen, meine Damen und Herren, am heutigen Abend, vom Marktplatz kommend, zu Fuß erreicht, muss eigentlich angerührt sein von dem ersten Eindruck, der sich ihm bietet. Das bescheidene Torhaus, Teil eines verwinkelten Ensembles, der sogenannten Bastille, durch das hindurch man auf den Schlossvorplatz gelangt, könnte der Zugang zu einem unbedeutenden Rittergut, könnte der Rest einer kleinstädtischen Befestigung oder auch das Vorgebäude einer dahinterliegenden Klosteranlage sein. Jede Illustration zu einer romantischen Erzählung aus dem Geist eines Ludwig Tieck oder E.T.A. Hoffmann fände – vor allem bei Mondschein – in diesem spätmittelalterlichen Gemäuer ihr passendes Sujet.
Und doch ist dieses Überbleibsel historischer Frühzeit der älteste Teil der großherzoglich sachsen-weimarischen Hauptresidenz. Er hat alle Katastrophen, Kriege und Brände, die in einem halben Jahrtausend über das Schloss hinwegfegten, nahezu unversehrt überstanden. Das Erstaunlichste an diesem Befund ist aber nicht die konservatorische Gesinnung des Zufalls, der das klapprige Häuschen immer wieder verschonte. Noch am 9. Februar 1944, als erhebliche Teile der Weimarer Altstadt durch einen Bombenangriff zerstört wurden, verfehlte eine Luftmine, die auf dem Schlossvorplatz einen riesigen Krater aufriss und den damals gerade einmal 30 Jahre alten Südflügel erzittern ließ, das Torhaus nur um wenige Meter.
Nein, das Erstaunlichste ist, dass die auf Repräsentation bedachten und der Bauwut immer wieder frönenden Herzöge von Sachsen-Weimar diese Manifestation einer Kleinstherrschaft über Jahrhunderte geduldet haben.
Schon im 17. Jahrhundert muss dieses bescheidene, leicht verkorkst wirkende Bauwerk wie ein Symbol politischer und gesellschaftlicher Rückständigkeit gewirkt haben. Gerade erst hatte Herzog Ernst I., der Fromme, in Gotha ein großes, hochmodern aus einem Guss konzipiertes Schloss, den Friedenstein, errichten lassen. Und doch dachte Herzog Wilhelm IV. von Sachsen-Weimar gar nicht daran, die ›Bastille‹ abzureißen, als auch er sich anschickte, das 1618 abgebrannte Weimarer Schloss, den Hornstein, nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges in barocken Formen wieder aufzubauen.
Sie aufzugeben kam auch eineinhalb Jahrhunderte später, als Herzog Carl August die erneut ausgebrannte Schlossanlage wieder errichtete und dafür bedeutende Architekten verpflichtete, nicht in Betracht, obwohl sie nun, rein ästhetisch betrachtet, definitiv ›gestört‹ haben muss. Und selbst der letzte ernestinische Bauherr, Großherzog Wilhelm Ernst, rührte die Bastille nicht an, als er dem dreiflügeligen Schloss ab 1912 einen steif-konventionellen Südflügel vorsetzen ließ.
Noch ihm, dem Letzten, erschien das kleine Torhaus heilig und unantastbar. Warum?

Eindrücke vom Neujahrsempfang der Klassik Stiftung Weimar. Foto: Candy Welz
Man darf nicht achtlos hindurchgehen, man müsste davor stehen bleiben und den Blick erheben, um auf diese Frage eine Antwort zu finden. Zunächst allerdings würde dem Betrachter dann die Schlichtheit, ja Kläglichkeit des Gebäudes erst so recht ins Auge fallen: Die Fenster gehorchen keiner Axialität; der Torbogen und das Wappenfeld darüber kommen zu keiner ansprechenden Geltung, weil beide, die eigentlich die Fassade bestimmen sollten, stattdessen von einem deplatziert wirkenden Fensterchen »bekrönt« werden; der Torbogen selbst ist ein wenig eingesunken, als wolle er die ihm aufruhende Last länger nicht tragen.
Und doch ist dort, im Schlussstein des Bogens und im Wappenfeld darüber, gleich zweimal das Signum zu sehen, das es zu lesen gilt: Es sind die Schwerter der sächsischen Kurfürsten.
In Weimar hatte Johann der Beständige, der mitregierende Bruder Friedrichs des Weisen und – nach dessen Tod im Jahr 1525 – Kurfürst von Sachsen, ab 1513 eine eigene Residenz errichtet. Hier wuchs Johann Friedrich der Großmütige auf, der seinen Vater 1532 als Kurfürst beerbte. Als Beschützer der Reformation und mächtiger Reichsfürst wurde er zum wichtigsten Gegenspieler Kaiser Karls V.
Als er von diesem 1547 in der Schlacht bei Mühlberg erst geschlagen, dann gedemütigt, zum Tode verurteilt und schließlich zu lebenslanger Haft begnadigt wurde, verloren die Ernestiner nicht nur einen Großteil ihres Territoriums, sondern vor allem auch die Kurwürde, die an den albertinischen Zweig des Hauses Wettin überging.
Der Fall Johann Friedrichs war tief, es blieb ihm – Weimar.

Eindrücke vom Neujahrsempfang der Klassik Stiftung Weimar. Foto: Candy Welz
Dort, über dem Eingang zum Torbau des Schlosses, musste das sächsische Wappen mit seinen kurfürstlichen Schwertern nun – im Sinne eines in Stein gemeißelten Bestandsschutzes – den Beweis dafür antreten, dass hier ein »geborener Kurfürst« residierte. Als authentisches Zeichen seiner Würde wurde dieses bescheidene Bauwerk so symbolisch zum Gegenteil dessen, was es realiter vorstellte: Es unterstrich den nicht aufgebbaren und tatsächlich niemals aufgegebenen Anspruch der Ernestiner darauf, nicht nur in den Kreis der Kurfürsten zu gehören, sondern auch und vor allem die wahren Protektoren des evangelischen Bekenntnisses zu sein.
Religiöses Bekenntnis und realpolitischer Bedeutungsverlust sind in dieser Dynastie unauflöslich miteinander verwoben.
Man kann ihre Geschichte und ihre Bedeutung, die zweifellos größer waren, als es die engen Grenzen ihres Territoriums vermuten lassen, nicht verstehen, wenn man die unerhörte Kränkung, die mit dem Beginn ihrer verbliebenen Herrschaft in Weimar verbunden war, nicht in den Blick nimmt. Die Bastille ist das authentische Zeugnis dieser Kränkung – und doch zugleich das Unterpfand ihres berechtigten, weil historisch verbürgten Stolzes. Diese Ambivalenz, man könnte sagen: eine für die Ernestiner konstitutive Dialektik, hat die Unruhe in der Lebensuhr dieser Familie immer angetrieben, und sie ist das eigentliche Motiv ihrer Herrschaft, mit der sie ab 1547 für dreihundertsiebzig Jahre die Geschicke ihres zerstückelten Territoriums in der Mitte des Deutschen Reiches von Weimar und Gotha sowie von zahlreichen weiteren Residenzen aus bestimmen sollte.
Vielleicht ist diese für Weimar, den Memorial- und Identitätsort der Deutschen schlechthin, so überaus typische und wirkmächtige Mischung aus Superioritätsbewusstsein und Verlustschmerz und die aus dieser Mischung resultierende Labilität des politischen Bewusstseins der eigentliche und prägende Einfluss, den die Ernestiner in den kollektiven Identitätshaushalt der Deutschen eingebracht haben – mit Folgen für die deutsche Nationalgeschichte, die bis heute wirksam sind. Kompensatorische Leistungsbereitschaft und eine damit einhergehende anspruchsvolle Moralität einerseits, der Generalverdacht gegenüber der Legitimität des Politischen im allgemeinen und seiner Normen und Regeln im Besonderen andererseits, sie kennzeichnen in Deutschland die Sphäre des Öffentlichen bis in die Gegenwart, und sie sind ein wesentlicher Grund dafür, dass seine europäischen Nachbarn oft ratlos vor der Frage stehen, woran sie denn mit uns Deutschen nun eigentlich sind.

Eindrücke vom Neujahrsempfang der Klassik Stiftung Weimar. Foto: Candy Welz
Größe und Tragik des Hauses Wettin und insbesondere des ernestinischen Zweiges dieses Hauses müssen uns bewusst sein, wenn wir die deutsche Geschichte und die Ideengeschichte von der Reformation bis zur Moderne verstehen wollen. Denn mit der Reformation, die Friedrich III., der Weise, schützte und die sein Bruder, Johann der Beständige, dann, nach Friedrichs Tod, gemeinsam mit seinem Sohn Johann Friedrich dem Großmütigen im Kurfürstentum Sachsen durchsetzte, übernahm das kurfürstlich-ernestinische Haus Sachsen die Protagonistenrolle in einem weltgeschichtlichen Drama, das mit der Ausrufung des Christentums zur Staatsreligion durch Kaiser Theodosius im Jahr 380 aufgeschrieben war, aber erst elfeinhalb Jahrhunderte später in Szene gesetzt wurde:
Gottesbekenntnis und Gehorsam gegenüber der weltlichen Herrschaft fallen nicht länger in eins.
Jetzt wird eine Naht tatsächlich aufgetrennt, die durch die ursprüngliche christliche Botschaft bereits in die tatsächlichen Verhältnisse auf Erden eingezeichnet war: »So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!« Matth. 22,21.
Die Menschen ahnten die Dramatik des Geschehens, ohne sich ihrer Ahnungen ganz bewusst zu sein, sie waren voller Unruhe und Sorge. 1493 erscheint die Schedelsche Weltchronik. Sie ist in sieben Weltalter aufgeteilt. Fünf Weltalter durchläuft Gottes Schöpfung vom Paradies bis zur Ankündigung Jesu. Dann folgt das sechste Weltalter, das mit der »Fülle der Zeit«, Gal. 4,4, also mit Jesu Geburt beginnt und bis auf den heutigen Tag, das Jahr 1493, währt. Jetzt steht nur noch das 7. Zeitalter aus, in dem der Antichrist erscheinen wird, womit sich die Wiederkehr Christi und das Jüngste Gericht ankündigen.
In diesem Jahr 1493 macht sich auch auf Friedrich III. aus Wittenberg, um nach Jerusalem zu pilgern. Dort wird er der Reliquiensucht verfallen; Reliquien sind die Lebensversicherungen dieser Zeit, denn sie schaffen Zuversicht, dem Grauen des Gerichts standhalten zu können. Unterdessen kehrt Columbus aus seiner Neuen Welt nach Europa zurück.
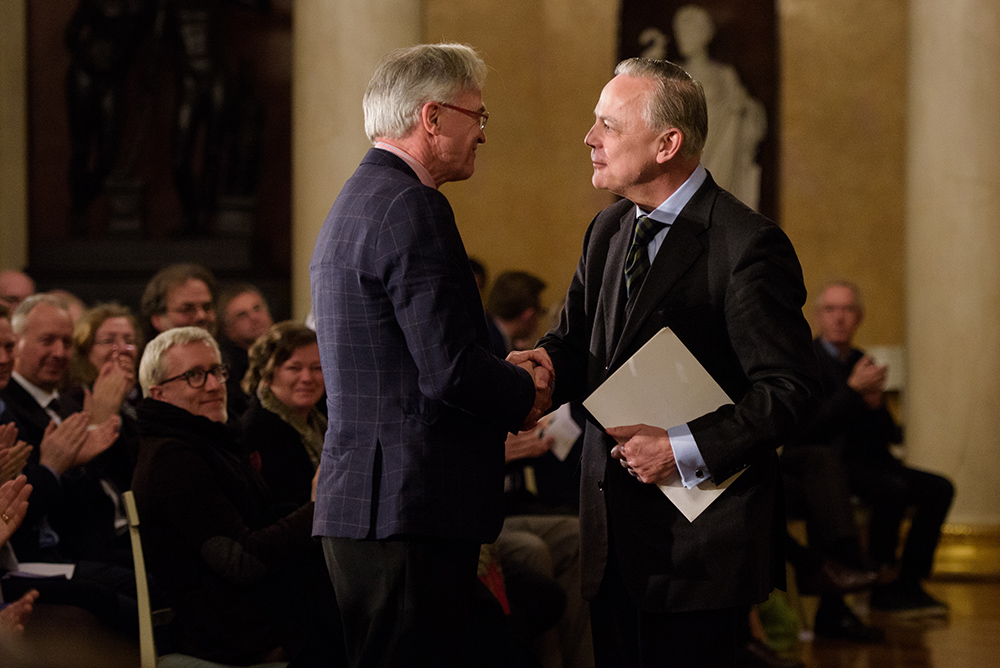
Eindrücke vom Neujahrsempfang der Klassik Stiftung Weimar. Foto: Candy Welz
Ohne die Erwartung des Weltendes ist die Reformation nicht zu verstehen.
Man könnte auch sagen: Die Religion wird, nein, nicht gezündet, wohl aber scharf gestellt. Das Ende der Zeiten steht bevor. Jeder einzelne ist jetzt seines Jenseitsglückes Schmied. Nicht länger die Kirche, der Papst, der Kaiser vermitteln mir die Gnade Gottes. Ich allein habe dafür zu sorgen.
Noch Karl Marx faszinierte dieses Welt-Schauspiel. In seiner Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie von 1844, ein Text, den ich dem Gläubigen und dem Verächter des Glaubens gleichermaßen zur Lektüre empfehle, weil es vor dem Hintergrund der seit seinem Erscheinen stattgehabten Geschichte durchaus nicht im Voraus zu sagen ist, wen von den beiden Lesern dieser Text mehr erschüttern sollte, in dieser Einleitung also schreibt Marx:
»Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, daß der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei (ich füge ein: also Gott und fahre im Zitat fort:) Deutschlands revolutionäre Vergangenheit ist nämlich theoretisch, es ist die Reformation.
Wie damals der Mönch, so ist es jetzt der Philosoph, in dessen Hirn die Revolution beginnt.
Luther hat allerdings die Knechtschaft aus Devotion (hier im Sinne von: Unterwürfigkeit) besiegt, weil er die Knechtschaft aus Überzeugung an ihre Stelle gesetzt hat. Er hat den Glauben an die Autorität gebrochen, weil er die Autorität des Glaubens restauriert hat. Er hat die Pfaffen in Laien verwandelt, weil er die Laien in Pfaffen verwandelt hat. Er hat den Menschen von der äußern Religiosität befreit, weil er die Religiosität zum innern Menschen gemacht hat. Er hat den Leib von der Kette emanzipiert, weil er das Herz in Ketten gelegt. Aber, wenn der Protestantismus nicht die wahre Lösung, so war er die wahre Stellung der Aufgabe.«

Eindrücke vom Neujahrsempfang der Klassik Stiftung Weimar. Foto: Candy Welz
Der Protestantismus hat die Aufgabe in der Reformation richtig gestellt. Deshalb ist Marx so wütend, dass Deutschland heute, 1844, als Schlusslicht den »modernen Nationen«, die nämlich der wahren Lösung schon näher sind, hinterherfährt.
Aber Deutschland hat etwas, was die anderen nicht haben: Die Philosophen, in denen die finale Revolution sich bereits vorbereitet, wie sich einst in den Reformatoren die wahre Befreiung präformierte. Und so wird die Deutschland-Kritik von Marx unversehens zur Apotheose des Deutschen:
»In Deutschland kann keine Art der Knechtschaft gebrochen werden, ohne jede Art der Knechtschaft zu brechen. Das gründliche Deutschland kann nicht revolutionieren, ohne von Grund aus zu revolutionieren.Die Emanzipation des Deutschen ist die Emanzipation des Menschen. Der Kopf dieser Emanzipation ist die Philosophie, ihr Herz das Proletariat.«
Das ist wahrlich nicht weit vom deutschen Wesen, an dem die Welt genesen solle, entfernt. Und nur am Rande sei bemerkt, dass die Mechanik dieser Superiorität aus Unterlegenheit auch in Schillers Gedichtentwurf über Deutschlands Größe präfiguriert ist. Die Geburtsstunde aber dieses unbekömmlichen Gemischs aus Minderwertigkeitskomplex und Größenwahn ist der ernestinische Untergang auf den Elbauen vor der Stadt Mühlberg im Jahr 1547. Man sieht es dem hübschen brandenburgischen Städtchen, das Vergessen durch die Zeit träumt, nicht an, dass vor seinen Toren europäische Geschichte geschrieben wurde. Hier entspringt aber vor allem die ideengeschichtliche Quelle, die die konfessionelle Zerrissenheit Deutschlands, die daraus erwachsende politische Ohnmacht und den daraus sich entwickelnden Sonderweg Deutschlands als Größe und nicht als historisches Verhängnis denkt.
Die große Erzählung von Mühlberg an der Elbe hat, wie sollte es anders sein, auch ihren Judas: Moritz, den albertinischen Herzog von Sachsen und Markgraf von Meißen. Die dreißig Silberlinge, das ist die Kurwürde, die Karl V. ihm versprach – und dann auch gewährte -, wenn er bereit sein würde, ihn, den Kaiser, im Kampf gegen seinen Cousin Johann Friedrich zu unterstützen. Der Riss, der nach Mühlberg durch Deutschland ging, er wurde auch in der Familie Sachsen nie wieder geheilt; man könnte deshalb sagen, dass dieses Haus das deutscheste unter allen deutschen Fürstenhäusern ist. Auf jeden Fall aber gilt seitdem, in Abwandlung eines bekannten Bonmots: Ernestiner und Albertiner sind zwei Familien, die durch ein gemeinsames Wappen voneinander getrennt sind.

Eindrücke vom Neujahrsempfang der Klassik Stiftung Weimar. Foto: Candy Welz
Goethe, der seinem Ernestiner, dem Herzog Carl August, mit dem Venezianischen Epigramm eine liebevolle Respektlosigkeit dedizierte, stellte sich, anders als Marx, ideengeschichtlich nicht in die Traditionslinie Luthers und der Reformation. Dazu hatte er als Bub in Frankfurt unter dem zeitgenössischen Luthertum einfach zu sehr gelitten. Der Held seiner Religionskritik und emanzipatorischen Autonomie heißt stattdessen bekanntlich Prometheus. Dadurch rückt diese Kritik aus den deutschen Zusammenhängen heraus, sie wird tatsächlich universal, aber ohne deshalb das deutsche Wesen als eine Universalie zu hypostasieren. Dafür, ich stehe nicht an, es zu sagen, liebe ich ihn. Dadurch wird er für mich anschlussfähig auch für heutige Diskurse und die Handlungsoptionen, die sie erschließen.
Genau eine solche Suche nach Optionen will das Goethe-Institut unternehmen, wenn es Angehörige der jungen Eliten aus der ganzen Welt ausgerechnet nach Weimar einlädt, um in unserer Stadt vom 1. bis 3. Juni über Formen zu sprechen, die geeignet erscheinen, die Kräfte nach innen und nach außen zu wenden. Das Kultursymposium steht unter dem Titel »Teilen und Tauschen«. Bei der Suche nach Wegen, wie wir in einer Weltgesellschaft unsere menschliche Kondition erhalten und zugleich entfalten können, kommen Grundformen der Vergesellschaftung wieder in den Blick, die aus der Nachbarschaft, der Communitas, der Allmende und dem Gemeinbesitz erwachsen sind:
Es sind Formen der Vergesellschaftung, die zunächst einmal zu der Region gehören, in der sich mein Leben tatsächlich abspielt. Nur wo wir tätige Mit-Verantwortung übernehmen, wo wir also Lebensformen entfalten, die es uns erlauben, die Kräfte tatsächlich nach innen und außen zu wenden, wo wir teilen und tauschen können, nur in solchen Lebensformen werden wir aus der untätigen Weltsorge heraustreten und uns zugleich vor dem tätigen Hochmut der Welterlösung hüten.

Eindrücke vom Neujahrsempfang der Klassik Stiftung Weimar. Foto: Candy Welz
Kultur wird bei diesem Projekt eine entscheidende Rolle schon allein deshalb spielen, weil Sprache, die Conditio sine qua non von Kultur, sich in denselben Mustern verwirklicht, die auch für die Formen unseres Zusammenlebens wieder fundamental werden müssen: Wir tauschen uns aus, wir teilen uns mit. Kultur kann aber zugleich die Metapher dafür sein, dass wir durch Teilen und Tauschen bereichert werden.
SAID, der deutsche Dichter, der seit 1965 im deutschen Exil lebt, um der Unterdrückung in seiner Heimat Iran zu entkommen, SAID hat 2006 in diesem Saal für seine Verdienste um die deutsche Sprache und für sein unentwegtes Eintreten für die Befreiung verfolgter Schriftsteller in seiner Heimat die Goethemedaille verliehen bekommen. Wir vergessen oft, dass wir auch am Ende des letzten und zu Beginn unseres Jahrhunderts schon einmal eine jahrelange Debatte über Flüchtlinge und Fluchtursachen in Deutschland geführt haben. Damals ging es um die Frage eines deutschen Einwanderungsgesetzes, das bekanntlich nicht zustande kam. Zu groß war die Sorge vieler Bürger vor einer Überfremdung der deutschen Kultur.
SAID, darauf angesprochen, sagte damals, 2003, einen Satz, den ich mir vollständig zu Eigen gemacht habe und von dem ich glaube, dass er auch Goethe gefallen hätte:
»Ich als unbedingter Verehrer dieser (also der deutschen) Kultur, habe meinen Zweifel, ob die Deutschen ihre Kultur kennen und sich ihrer bewußt sind. Denn nur der hat vor Überfremdung Angst, der seine eigene Kultur nicht kennt und nicht schätzt.«
»Klein ist unter den Fürsten Germaniens freilich der meine;
Kurz und schmal ist sein Land, mäßig nur, was er vermag.
Aber so wende nach innen, so wende nach außen die Kräfte
Jeder; da wär‘s ein Fest, Deutscher mit Deutschen zu sein.«
















